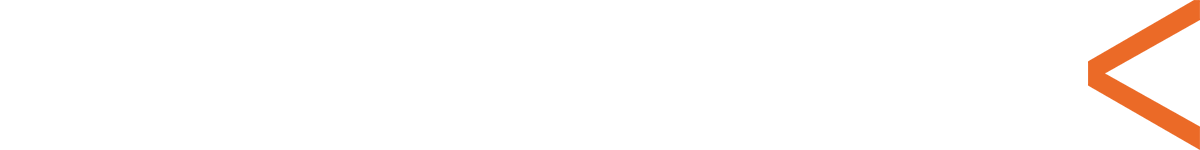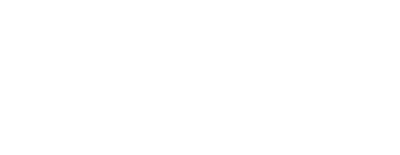Am 23. Februar 2025 entscheidet sich, welche Partei künftig die Bau- und Wohnungspolitik Deutschlands prägen wird. Eine Analyse der Wahlprogramme von Prof. Dr. Andreas Koenen, Fachanwalt für privates und öffentliches Baurecht, zeigt: Die Pläne sind ambitioniert, doch viele Vorhaben stehen vor erheblichen rechtlichen Hürden.
Ein Überblick über die zentralen Positionen der Parteien in den Bereichen Bauvorschriften, Wohnungsbau, Mietrecht und Klimaschutz. Prof. Koenen analysiert die zentralen Vorhaben der Parteien und bewertet deren rechtliche Umsetzbarkeit. Im Fokus stehen dabei das öffentliche Baurecht, das Mietrecht, die Wohnungsbauförderung sowie die energetischen Anforderungen.
CDU: Weniger Regulierung – aber mit welchen Folgen?
Die CDU setzt auf eine Entschlackung der Bauvorschriften, um den Wohnungsbau zu beschleunigen. Geplant sind Reformen des Bauplanungsrechts und Sonderregelungen für angespannte Wohnungsmärkte. Allerdings liegt das Bauordnungsrecht bei den Ländern, sodass eine bundesweite Deregulierung schwierig wird. Auch die angekündigte Reform zur Reduzierung technischer Normen bleibt vage.
Zur Wohnraumförderung will die CDU verstärkt ungenutzte Flächen aktivieren und soziale Wohnbauförderung ausweiten. Zudem sollen steuerliche Anreize für Wohneigentum verbessert werden. Im Mietrecht verspricht die CDU „wirksamen Mieterschutz“, bleibt jedoch unkonkret. Besonders umstritten ist ihr Plan, das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abzuschaffen – ein Schritt, der mit EU-Recht kollidieren könnte.
SPD: Starke staatliche Steuerung mit rechtlichen Fallstricken
Die SPD setzt auf eine strikte Regulierung des Mietmarktes. Geplant sind eine unbefristete Mietpreisbremse, Einschränkungen bei Indexmieten sowie strengere Regeln für Eigenbedarfskündigungen. Die Umsetzung dürfte jedoch verfassungsrechtlich problematisch sein, da sie das Eigentumsrecht einschränkt.
Zur Förderung des Wohnungsbaus plant die SPD einen staatlichen Deutschlandfonds für Genossenschaften, die Stärkung des kommunalen Vorkaufsrechts und eine neue Wohngemeinnützigkeit. Ob diese Maßnahmen finanzierbar sind, bleibt fraglich. Auch ihr Vorschlag, die CO?-Kosten vollständig auf Vermieter abzuwälzen, könnte verfassungsrechtliche Probleme aufwerfen.
FDP: Bürokratieabbau mit rechtlichen Risiken
Die FDP setzt auf schnellere Genehmigungen und eine Reduzierung von Bauvorschriften. Eine Genehmigungsfiktion, die Bauanträge automatisch genehmigt, falls Behörden nicht fristgerecht reagieren, könnte jedoch mit dem Verfassungsrecht kollidieren. Die geplanten bundesweiten Standards für serielle Bauweisen könnten mit den Bauordnungen der Länder in Konflikt geraten.
Im Mietrecht will die FDP die Mietpreisbremse abschaffen und Kappungsgrenzen für energetische Sanierungen lockern. Auch sie plant steuerliche Anreize für Investoren, um den Wohnungsmarkt zu beleben.
Grüne: Klimaschutz als Priorität – mit rechtlichen Herausforderungen
Die Grünen fordern einen weitreichenden Mietenstopp, strengere Eigenbedarfskündigungsregeln und die Schließung von Steuerschlupflöchern für Immobiliengeschäfte. Ein genereller Mietendeckel könnte jedoch gegen das Grundgesetz verstoßen.
Im Bausektor setzen sie auf nachhaltige Sanierungspflichten und hohe Umweltstandards für Neubauten. Hausbesitzer sollen beim Umstieg auf fossilfreie Heizsysteme mit bis zu 70 % staatlicher Förderung unterstützt werden. Eine verpflichtende Sanierung könnte jedoch Eigentümer finanziell überfordern und rechtliche Anfechtungen nach sich ziehen.
AfD: Nationale Alleingänge mit rechtlichen Grenzen
Die AfD lehnt „ideologiegetriebene“ Bauvorgaben ab und will das Gebäudeenergiegesetz sowie die CO?-Steuer abschaffen. Doch diese Maßnahmen sind kaum umsetzbar, da sie gegen EU-Recht verstoßen. Auch ihr Vorschlag, deutsche Bürger bei der Wohnungsvergabe zu bevorzugen, dürfte gegen das Grundgesetz und EU-Recht verstoßen.
Statt sozialem Wohnungsbau setzt die AfD auf Wohngeldförderung. Eine vollständige Abschaffung der Mietpreisbremse wäre rechtlich möglich, könnte jedoch zu sozialen Spannungen führen.
Fazit: Viele Versprechen, wenig klare Lösungen
Alle Parteien versprechen Maßnahmen zur Bekämpfung der Wohnungsnot, doch viele Pläne bleiben vage oder sind rechtlich schwer umsetzbar. Während CDU und FDP auf Deregulierung setzen, streben SPD und Grüne eine stärkere staatliche Steuerung an. Die AfD setzt auf eine fundamentale Kehrtwende mit potenziellen EU-Konflikten.
Klar ist: Die kommende Regierung wird sich nicht nur an politischen Zielen, sondern auch an rechtlichen Machbarkeiten messen lassen müssen. Der Wohnungsmarkt bleibt ein zentrales Thema – doch wie viel Regulierung braucht er, und wie viel hält er aus?