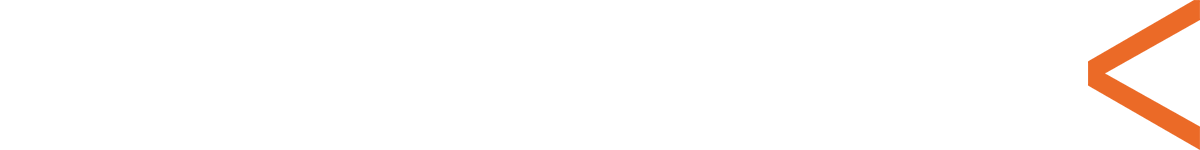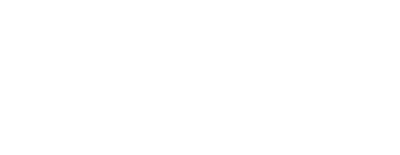Die Wirtschaftsförderung gehört zu den Kernaufgaben der kommunalen Politik. Gerade für die Immobilienbranche spielen die einzelnen Ämter oder Gesellschaften der Wirtschaftsförderung eine wichtige Rolle. Mit verschiedenen Instrumenten wird die urbane Transformation in eine politisch gewünschte Richtung gelenkt. Je nach Wirtschaftszweig, auf den sich die Ansiedlungspolitik fokussiert, verändern sich auch die Perspektiven und Rahmenbedingungen der Immobiliennutzung.
Die Wirtschaftsförderung versteht sich mitunter als Kümmerer, Mittler oder Mediator, manchmal auch als Netzwerker. „Wir möchten in unserem Fall auch Gestalter sein, um für Krefeld den entscheidenden Unterschied zu machen“, meint Annegret Angerhausen-Reuter, zuständig für die Projekt- und Investorenbegleitung bei Krefeld Business, der kommunalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft. „Wir bringen unsere Stadt aktiv auf den Investmentradar der institutionellen Investoren und von Family Offices, um den Wandel unserer Region nicht nur zu verwalten, sondern zu managen.“ Mit einem Beispiel der Gestaltung macht Krefeld von sich reden. Der ehemalige und durch die bisherigen Eigentümer mittlerweile veräußerte Kaufhof der Stadt wurde durch eine kommunal gesteuerte Taskforce binnen eines Jahres durch einen Investor und einen neuen Ankermieter einer Weiternutzung zugeführt. Dafür wird knapp die Hälfte der 15.000 Quadratmeter von der Volkshochschule (VHS) bezogen. Zusätzlich entwickelt der neue Eigentümer geförderte Studentenwohnungen und Serviced Apartments in den oberen Stockwerken. „Mit der langfristigen Miete durch die VHS haben wir den Investor von Krefeld überzeugen können“, zeigt sich Annegret Angerhausen-Reuter zufrieden von der Entwicklung.
Kerngeschäft Kontaktvermittlung
Die meisten Wirtschaftsförderungen sind proaktiv auf der Suche nach Unternehmen für eine Neuansiedlung in den jeweiligen Regionen. Dabei können auch Städte, die bislang bei international agierenden Unternehmen eher unbekannt waren, mit verschiedenen Vorteilen auf sich aufmerksam machen. Die Kontaktvermittlung zu Politik und Verwaltung bildet das Kerngeschäft. Hierbei gibt es aber unterschiedliche Herangehensweisen. Das hat einerseits mit politischen Wünschen zu tun, aber auch die Geographie setzt natürliche Grenzen.
In Jena beispielsweise liegt die Stadt eingekeilt im Tal der Saale. Die Bevölkerung der Zeiss-Stadt ist in den letzten zehn Jahren um zehn Prozent gewachsen. „Wir haben ein gutes Gründungsklima, auch wenn der Platz eher knapp ist“, sagt Markus Henkenmeier, Leiter des Wirtschaftsservice Jena. „Als einzige Stadt in Thüringen mit einer Volluniversität und dem Traditionsunternehmen Zeiss sind wir gerade für Innovationsfirmen ein attraktiver Standort.“ Man versteht sich hier zudem als One-Stop-Agency zur Problemlösung der anfragenden Unternehmen. Gleichzeitig sorgt der breite und starke Mittelstand für ein natürliches Binnenwachstum der Jenaer Wirtschaft. Zusätzlich verfügt die zweitgrößte Stadt Thüringens seit einigen Jahren über eine eigene Hochhausrahmenplanung, um dem Wachstum durch eine Nachverdichtung in die Höhe zu begegnen. Steigende Spitzenmieten von mittlerweile 14,70 Euro, ein Anstieg der Durchschnittsmiete um knapp fünf Prozent jährlich seit 2015 sowie ein Leerstand von gerade einmal zwei Prozent weisen die Attraktivität von Jenas Gewerbeimmobilienmarkt auf.
Kommunale Gesellschaft als Schnellboot der Akquise
In Leipzig hat sich die Wirtschaftsförderung ein besonderes Organisationsmodell gegeben: Neben dem Amt der Stadtverwaltung wurde mit der Invest Region Leipzig zusätzlich eine kommunale Gesellschaft gegründet. Diese dient in der Unternehmensansprache als „Schnellboot für eine erste Akquise“, wie Sophie Martin von der Invest Region Leipzig es beschreibt. Wird das Interesse konkret und hat sich ein Unternehmen für eine Kommune im Landkreis entschieden, übernimmt das Amt die weitere Betreuung. „Unsere Mitarbeiter sind in Clustern organisiert und Experten in den jeweiligen Branchen. So begegnen wir den Unternehmen auf Augenhöhe und verstehen besonders gut die unterschiedlichen Ansprüche bei der Ansiedlung“, meint Anja Hähle-Posselt, Amtsleiterin der kommunalen Wirtschaftsförderung. Insbesondere die Branchen IT, Umwelttechnik sowie Biotechnologie und Health Care stehen im Fokus. Mit einer im Aufbau befindlichen Immobiliendatenbank steht man den Unternehmen hilfreich zur Seite. Hier finden sich auch Bebauungspläne und digitale Zwillinge. Die internationale Bekanntheit der Stadt erleichtert den Wirtschaftsförderern die Arbeit. Der Popularitätsgrad hat durch den sportlichen Erfolg des örtlichen Fußballklubs nochmal deutlich zugenommen. „Damit sind wir in der öffentlichen Wahrnehmung international gewachsen. Wir müssen internationalen Gesprächspartnern heute deutlich seltener erklären, wo Leipzig liegt“, sagt Sophie Martin. „Besonders auch Unternehmen mit speziellen Innovationen wie zum Beispiel Photovoltaikmodulen auf Fahrzeugen oder Superkondensatoren als Alternative zu Batterien konnten wir nach Leipzig holen.“ Mit verschiedenen Innovationszentren im Stadtgebiet bietet Leipzig den Unternehmen gute Bedingungen für enge Unternehmensnetzwerke. Die Zahl der Bewohner zwischen 20 und 35 Jahren ist seit 2006 um 23 Prozent gestiegen, die Bevölkerung insgesamt wuchs im selben Zeitraum um 16 Prozent.
Berlin: digitaler Wirtschaftsatlas zur Unternehmensansprache
Unter den vielfältigen Aufgaben der Wirtschaftsförderungen – darunter Standortmarketing, Unternehmensansiedlung oder Innovationsförderung – nimmt die Informationsbereitstellung zum Wirtschaftsstandort eine Schlüsselrolle ein. „Der Wirtschaftsatlas Berlin hält für nationale und internationale Unternehmen branchenspezifische, infrastrukturelle und planungsrechtliche Informationen bereit“, sagt Birgit Steindorf, Bereichsleiterin Location Service bei der Wirtschaftsförderung Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie. Im digitalen Atlas, den Birgit Steindorfs Team immer auf dem aktuellen Stand hält, erfährt das Unternehmen alle wichtigen Informationen zum Wirtschaftsstandort der Hauptstadt. Fernwärmeanschluss, Glasfaserversorgung, Bebauungspläne und weitere Informationen sind darin enthalten. Auch die in der Nachbarschaft ansässigen Unternehmen weist der Wirtschaftsatlas aus. Damit trägt man auch dem Wandel Berlins Rechnung. Die Stadt ist nicht mehr nur für Party und Politik bekannt. „Heute weiß jeder, dass Berlin ein Wirtschaftsstandort ist“, ergänzt Birgit Steindorf. Die Wirtschaftsförderung Berlin unterstützt Unternehmen mit vielen weiteren Services, unter anderem auch beim Thema Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigungen für internationale Mitarbeiter.
Wirtschaftsförderungen können im Wettbewerb um Unternehmen zunehmend selbstbewusst auftreten. So sieht es auch Martin Wolfrat, Partner bei Art-Invest in Hamburg: „Wirtschaftsförderungen leben vom Rückhalt der Stadt und dem Engagement für die Stadt.“ Nicht jede Ansiedlung wird um jeden Preis umgesetzt. „Die Zeiten, in denen sich Wirtschaftsförderungen von Unternehmen unter Druck setzen ließen, sind vorbei,“ stellt Markus Henkenmeier von Jena Wirtschaft fest. Gerade in vormals strukturschwachen Regionen liegt der Fokus klar auf Hochtechnologiearbeitsplätzen. Der rote Teppich wird deshalb noch lange nicht ausgerollt. Das Intel-Debakel in Magdeburg zeigt gut, welche Risiken in der Fokussierung auf einen großen Player liegen.
Eines eint die verschiedenen Wirtschaftsförderungen: der Wunsch nach einer guten Kooperation mit der Immobilienwirtschaft. Gewerbeflächen bilden eine entscheidende Säule neben dem Wohnraum für städtisches Wachstum. In Aachen kommt noch die Besonderheit des Drei-Länder-Ecks hinzu. Hier arbeitet man Hand in Hand gemeinsam mit den Niederlanden und Belgien. Aachen verfügt mit der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) über eine Eliteuniversität, die angesichts der überschaubaren Größe der Stadt mit gut 250.000 Einwohnern ebenso als Magnet für Fachkräfte wie als Verjüngungskur für den Standort wirkt. Gleichzeitig steht das Rheinische Revier vor einem tiefgreifenden Strukturwandel, der mit dem Ende des Braunkohleabbaus in der Region zusammenhängt. Die hierfür bereitgestellten europäischen Fördermittel kommen zwar nicht den Unternehmen direkt zugute, fließen jedoch in den Ausbau der Infrastruktur. Davon profitieren sowohl der bereits vorhandene Mittelstand als auch Neuansiedlungen. Flächen sind hier nur begrenzt vorhanden. Daher fokussiert man sich bei der Akquise auf mittelständische Unternehmen. „Niemand wehrt sich, wenn wir auch ein großes Corporate in die StädteRegion Aachen ziehen können, aber die Basis des Wohlstandes in unserer Region bildet der etablierte, wirtschaftsstarke und universitär gut vernetzte Mittelstand“, sagt Sebastian Albring, Strukturwandelmanager der StädteRegion Aachen. Über eine zentrale Anlaufstelle der regionalen Wirtschaftsförderung werden interessierte Unternehmen an die entsprechenden Stellen vermittelt, Kontakte angebahnt und auch bei der Suche nach geeigneten Gewerbeflächen aktiv unterstützt. Aachen hat — ähnlich wie Berlin — seit mehreren Jahren mit dem „Gewerbeflächen-Informationssystem der Technologieregion Aachen“ (gisTRA) einen vollständig digitalen Gewerbeatlas. Dieser bietet den Interessenten schon vorab eine große Informationsvielfalt, um eine Ansiedlung zu planen.
Eine auffällige Parallele besteht zu Krefeld: In einem ehemaligen Kaufhaus der Warenhauskette Horten existieren Pläne, die Volkshochschule gemeinsam mit der Stadtbibliothek unterzubringen. Zusätzliche gastronomische Angebote sollen die Revitalisierung der Innenstadt unterstützen. Hier soll aber die Stadt zum Eigentümer werden; der politische Prozess rund um das Projekt läuft derzeit.
Nürnberg erhält eine neue Universität
Auch in Nürnberg sind die Gewerbeflächen knapp, wodurch eine Neuansiedlung von Unternehmen seitens der Wirtschaftsförderung nicht aktiv forciert wird. Der Fokus liegt auf den bestehenden Gewerbegebieten, deren Attraktivität langfristig erhalten bleiben soll. Dazu wurden die vorhandenen Flächen nach ihrer dominierenden Nutzung typologisiert. Aufgrund der spezifischen Anforderungen unterschiedlicher Gewerbe sollen einzelne Gebiete einer vorwiegenden Nutzungsart dienen. „Bei der Weiterentwicklung der Gewerbeflächen verfolgen wir das Ziel, Nutzungstypen mit ähnlichen Anforderungen an das Standortumfeld räumlich zu bündeln. Davon profitieren vor allem die Unternehmen, da ihren Bedarfen an einen geeigneten Gewerbestandort so deutlich besser entsprochen werden kann. Freilich kann dieses Ziel nur langfristig und im Wesentlichen mit ‚weichen Mitteln‘ erreicht werden“, sagt Dr. Susanne Hoffmann, Leiterin der Wirtschaftsförderung. „Nürnberg hat über alle Nutzungsarten hinweg einen Mangel an verfügbaren Gewerbeflächen. Daher können wir nicht allen Anfragern geeignete Flächen im Stadtgebiet anbieten.“
Nürnberg verfügt durch die große Hochschullandschaft mit 16 Einrichtungen innerhalb der Metropolregion über eine Besonderheit: die jüngste Universitätsgründung Deutschlands. An der Errichtung der Technischen Universität Nürnberg (UTN) — deren Gründung erst im Mai 2017 vom bayerischen Kabinett beschlossen worden war — war die Wirtschaftsförderung von Beginn an intensiv beteiligt. Zum 1. Januar 2021 nahm sie bereits den Lehrbetrieb auf. Gemeinsam mit den anderen Hochschulen ist auch die UTN für die Zukunft eine enorme Fachkräfteressource. Zusätzlich wirken ehemalige Studenten auch in ihren künftigen Wohnorten praktisch als Markenbotschafter für ihren ehemaligen Studienort. Das Beispiel Nürnberg zeigt: Auch eine Neugründung ist möglich und steigert die Attraktivität eines Standortes.