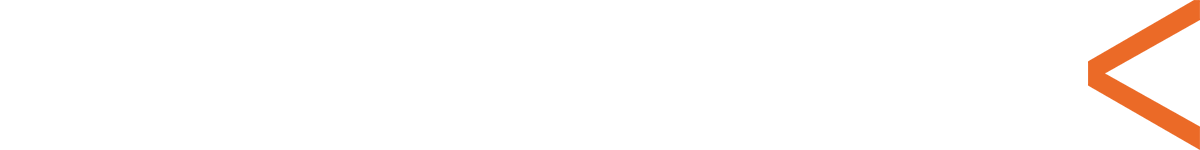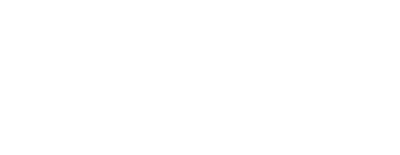Die sozial orientierte Wohnungswirtschaft steht unter Druck: Investitionsentscheidungen, Nachhaltigkeitsvorgaben, steigende Anforderungen von Politik, Mietern und Kapitalgebern. Die Zukunftstagung 2025 der mitteldeutschen Verbände macht deutlich: Der Wandel ist in vollem Gange, aber kein Selbstläufer.
„Manchmal kommt man sich wie ein lästiger Bittsteller vor. Das sind wir aber nicht.“ Mit klaren Worten fasste Mirjam Philipp, Vorstand beim Verband der Sächsischen Wohnungsgenossenschaften e.V., die aktuelle Situation zusammen. Es brauche eine selbstbewusste Stimme der sozial wohlorientierten Wohnungswirtschaft. Bei der ersten Mitteldeutschen Zukunftstagung, die vom VSWG sowie den Verbänden vdw Sachsen, vtw Thüringen, vdw Sachsen-Anhalt sowie dem vdwg Sachsen-Anhalt initiiert wurde, erinnerte sie daran, dass man mit über einer Million Wohnungen und fast 700 Mitgliedsunternehmen in Deutschland ein immobilienpolitisches Schwergewicht sei. Doch der Rückhalt auf Bundesebene sei nicht annähernd so präsent, wie es der Einfluss der Branche vermuten ließe: „Wir müssen mehr Aufmerksamkeit in Richtung Bund erhalten, weil wir ein Gewicht haben im wohnungspolitischen Zirkus.“ Gerade in Fragen wie der Stärkung des ländlichen Raums, der sozial gerechten Lastenverteilung oder der nachhaltigen Sanierung von Beständen brauche es mehr Konzentration – und aktive Positionierung.
Nachhaltigkeit: Zwischen Ideal und Realität
Friederike Leppert von DOMUS Consult brachte es in ihrem Vortrag auf den Punkt: Die Nachhaltigkeitsberichterstattung sei notwendig – aber in ihrer derzeitigen Form für viele kleine und mittlere Wohnungsunternehmen kaum zu stemmen. Zwar bietet der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK) erste Ansätze, doch sei dieser längst nicht mehr zeitgemäß. Die kommende CSRD-Richtlinie (Corporate Sustainability Reporting Directive) verlangt weit mehr – und stellt die Branche vor enorme Herausforderungen.
Praxisnahe Empfehlungen wie der ERFRAG-Standard könnten zwar helfen, stoßen jedoch auf strukturelle Schwierigkeiten: Bankenfragebögen sind oft nicht auf die Besonderheiten der Wohnungswirtschaft zugeschnitten, Finanzierungsfragen bleiben offen, und die Verbindung zwischen Berichtsanforderungen und tatsächlicher Bauplanung ist selten klar nachvollziehbar. Der ERFRAg-Standard ist ein freiwilliger Berichtsrahmen für kleinere und mittlere Unternehmen (KMU) zur Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der EU. Der Name allein steht für Komplexität: European Sustainability Reporting Standards for non-listed SMEs. Die CSRD verpflichtet große Unternehmen in der EU ab 2024 zur umfassenden Nachhaltigkeitsberichterstattung. Kleinere und mittlere Unternehmen sind nicht berichtspflichtig, können aber freiwillig berichten – insbesondere, wenn sie dies aus Gründen der Finanzierung, beispielsweise für ESG-Nachweise für Banken, der Transparenz oder im Rahmen von Lieferkettenbeziehungen tun wollen oder müssen. In ihrem Vortrag warnte Friederike Leppert zudem vor dem Risiko des Greenwashings: Wenn Unternehmen gesetzliche Mindeststandards als Erfolge verkaufen, statt echte Fortschritte transparent zu machen, könne das die Glaubwürdigkeit der gesamten Branche beschädigen.
Datenmanagement als Fundament
Ralf Schekira, Geschäftsführer der wbg Nürnberg zeigte, wie strategisch sinnvoll ein datenbasiertes Nachhaltigkeitsmanagement sein kann. Mit rund 19.000 Wohnungen sowie Aktivitäten als Bauträger – etwa für Kitas oder Schulen – nutzt die wbg Nürnberg Daten längst nicht mehr nur für die Bilanz, sondern zur langfristigen strategischen Steuerung. Datenbasierte Planung ermögliche es, Klimaziele in realistische Zehnjahrespläne zu übersetzen – objektgebunden, präzise und auf die jeweilige Bestandssituation angepasst. Je konkreter die Maßnahmenplanung am Objekt, desto höher die Umsetzungsgenauigkeit. Bereits 2022 wurde ein eigenes Nachhaltigkeitsteam etabliert. Die erste DNK-Erklärung – immerhin 90 Seiten – gab es 2023. Es hat viele personelle und finanzielle Ressourcen gebunden, deshalb sehe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge darauf“, so Ralf Schekira. „Allerdings haben wir das nicht umsonst gemacht, denn es gab eine Menge Learnings, die wir für unsere weitere Strategie gut einsetzen können.“ Die Nachhaltigkeitsberichterstattung sei kein Selbstzweck, sondern Teil eines integralen Managementsystems. „Die Richtung ist klar – aber viele der Maßnahmen bleiben ohne passende Softwarelösungen, Ressourcen und politische Unterstützung schwer umsetzbar.“
Finanzierungsfragen – neue Anforderungen, alte Strukturen
Brit Meyer, Business Development Managerin Wohnungswirtschaft & Tourismus bei der Deutsche Kreditbank AG (DKB), sprach über die tiefgreifenden Veränderungen bei der Finanzierung. Die klassische Bonitätsprüfung allein reicht nicht mehr: ESG-Faktoren spielen bei Kreditentscheidungen zunehmend eine Rolle. Grundlage ist der Green Deal der EU, der auch den Finanzsektor in die Pflicht nimmt. Die Herausforderung: „Es gibt zahlreiche Regularien, aber keine einheitlichen Standards. Auch wir als Bank bewegen uns in einem enger werdenden Handlungsrahmen.“ Der Druck zur Integration von ESG in Kreditprozesse wachse, gleichzeitig herrsche große Unsicherheit bei der Bewertung und Vergleichbarkeit von Maßnahmen.