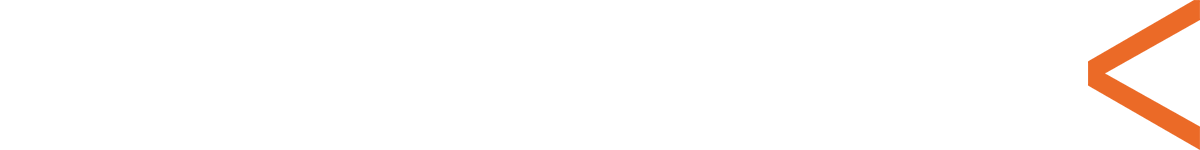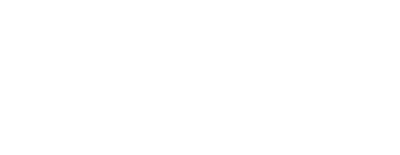Stefan Anderl, Geschäftsführer bei ELK TECH und ELK KAMPA, Prof. Dr. Winfried Schwatlo von der Schwatlo Management Consulting und Dirk Völkering, Partner bei RKW Architektur+ in Düsseldorf sind sich einig: Nachverdichtung wird komplexer. Warum und welche Strategien es gibt, haben sie in einem Webinar diskutiert.
„Nachverdichtung im Bestand und nahe am Bestand wird wichtiger werden. Ich sehe hier einen Paradigmenwechsel“, so Stefan Anderl von ELK TECH und ELK KAMPA. „Wir müssen uns auf Zeiten einstellen, wo Wohnen dichter wird.“ Sie gilt als zentrale Strategie für urbane Räume, um dem steigenden Wohnraumbedarf in deutschen Großstädten gerecht zu werden. Eine von der Berlin Hyp in Auftrag gegebene Kurzstudie hat im Sommer 2024 beispielsweise ein Potenzial von 625.000 zusätzlichen Wohnungen durch Nachverdichtung in Wohnquartieren der 1950er und 1960er Jahre ermittelt.
NIMBY ist heute meist dabei: Not in my backyard. Prof. Dr. Winfried Schwatlo von der Schwatlo Management Consulting, Mediator, Sachverständiger und erfahrener Experte auf diesem Gebiet, zeigt die Neuerungen auf: „Vor Jahren konnte man in diesen Konflikten noch mit sachlichen Argumenten punkten. Heute haben wir es mit Egoismus, Vorurteilen und Neid beispielsweise zu tun, also mit Dingen, die mit dem eigentlichen Projekt nichts zu tun haben“, sagt er. Das verändere auch die Prozesse und den Umgang mit Stakeholdern. „Jeder muss Raum bekommen, das ist ganz wichtig“, so Dirk Völkering, Partner bei RKW Architektur+ in Düsseldorf. „Es ist heute fast vermessen ein Projekt zu entwickeln, ohne die Umgebung einzubeziehen. Für viele sind die Projekte abstrakt, sie verstehen nicht, was da passiert.“ Zudem verweist er darauf, dass früher neue Entwicklungen als Fortschritt wahrgenommen worden, währenddessen sie heute eher negativ betrachtet werden.

Was schnell klar wird in der Diskussion der Experten: Heute reichen nicht mehr eine Homepage und ein Flyer. „Natürlich spielen auch hier die sozialen Medien eine große Rolle, hier muss man sich zeigen, auf Einwände reagieren“, so Winfried Schwatlo. Anhand eines Beispiels aus Österreich (www.digitalstadt.at) zeigt er auf, wie das funktionieren kann: Dank Avataren kann man sich in der mal entstehenden Stadt umsehen, was zu einer extrem hohen Akzeptanz geführt hat. Er ist zudem ein bekennender Freund der Bürgerbeteiligung: „Da entstehen sehr oft die besten Ideen.“ Integration durch Teilhabe nennt er das. „Analog trifft heute digital. Heute nutze ich eine geänderte Sprache, die einfacher und plakativer ist.“
„Jeder empfindet eine Baustelle vor der Tür als laut, dreckig und lang“, sagt Stefan Anderl. „Es kommt darauf an, dass man die Bauabläufe verträglicher gestaltet. Eine Möglichkeit ist Modulbau.“ Der sei etwa 40 bis 50 Prozent schneller. „Durch die Vorfertigung in der Halle gibt es auf der Baustelle lediglich die Montage, die nahezu lärm- und staubfrei ausgeführt wird.“ Weiterer Knackpunkt: die Politik vor Ort. „Wenn der Bürgermeister kneift, weil er nicht auf der falschen Seite stehen will, dann wird es meist auch mit der Akzeptanz schwierig“, so Winfried Schwatlo. Stefan Anderl ergänzt: „Es braucht Personen, die die Stimmung lesen können. Wenn es die nicht gibt, ist es schwierig. Das Klima wird oft vergiftet, weil die Menschen sich überrumpelt fühlen.“ Die Prozesse brauchen Zeit, Drängen und Treiben seien nicht förderlich.
„Viele Köche verderben hier eben nicht den Brei“, so Winfried Schwatlo. Entscheidend sei, dass man zuhöre und die Anliegen ernst nehme.